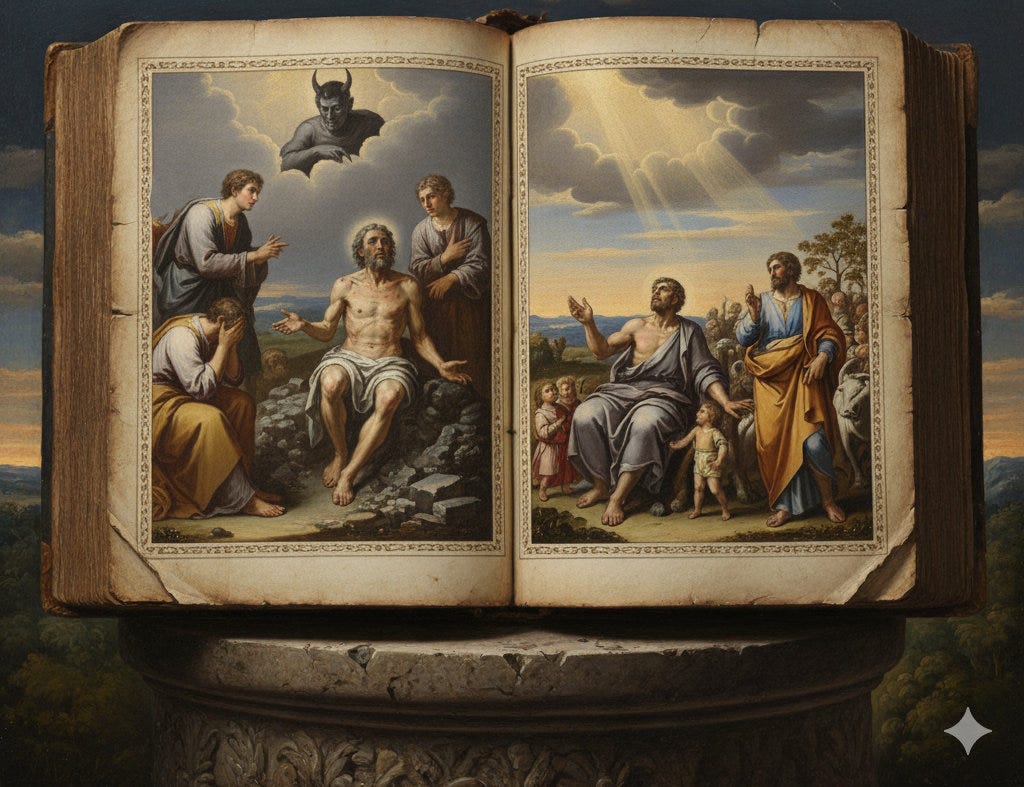Ja, Virginia, es gibt den Teufel!
Das Böse existiert, daran ändern auch jene nichts, die nicht an es glauben.
Zusammenfassung: Das Böse bleibt eine komplexe Realität, die von Philosophie und Theologie seit Jahrtausenden verhandelt wird. Ob wir es nun als „Mangel des Guten“ oder als „Banalität der Gedankenlosigkeit“ begreifen: Wer heute das Böse psychologisiert oder relativiert, riskiert, ihm unbewusst Tür und Tor zu öffnen. Die Leugnung des personifizierten Bösen, des Teufels, ist eine Flucht vor den unbequemen Wahrheiten des Glaubens. Dabei ist der Kern der guten Nachricht: Obwohl der Weg des Bösen einfach und verführerisch ist, ist seine Macht nicht unendlich. Es liegt in unserer willentlichen Entscheidung, wie viel Raum wir der Versuchung geben. Die bleibende Aufgabe ist es, wachsam zu bleiben und mutig den Unterschied zwischen Gut und Böse anzuerkennen, anstatt ihn in Bequemlichkeit oder intellektuellem Dünkel zu verwischen.
Gibt es das Böse? Ja, absolut.
Das Böse existiert in dieser Welt – doch seine Formen sind so vielfältig, dass es für uns schwer zu fassen ist. Schon die Frage, was das Böse eigentlich ist, führt uns mitten in eine jahrtausendealte Debatte zwischen Philosophie und der Theologie.
Vor Kurzem bin ich endlich dazu gekommen, den Film Never Let Go zu sehen. Halle Berry spielt darin eine Mutter von Zwillingen, die einsam in einem Haus irgendwo im Wald lebt. Das schützende Haus können die drei nur verlassen, wenn sie mit einem Seil damit verbunden bleiben. Nur dieser Kontakt schützt sie vor dem Bösen, denn schon eine Berührung führt zur Infektion.
Der 2024 erschienene Film hat einige Schwächen, aber ich will hier keine Filmkritik schreiben. Interessant ist Never Let Go, weil Regisseur Alexandre Aja gezielt die Meinung des Zuschauers manipuliert – mal in die eine, mal in die andere Richtung. Bis zum Schluss hält er das durch und liefert keine Auflösung des Rätsels. Die Zuschauerschaft dürfte also geteilter Meinung sein:
Handelt es sich bei der Angst vor dem Bösen außerhalb des Hauses um eine Psychose der Mutter, die nach ihrem Selbstmord endgültig auf einen der beiden Söhne übergeht? Dafür spricht, dass die vom Bösen besessenen Menschen nie von zwei Personen gleichzeitig gesehen werden – und dass die Mutter offensichtlich lügt, wenn sie ihren Kindern erzählt, draußen lebe kein Mensch mehr.
Oder schleicht tatsächlich das Böse um das Haus in den Wäldern und fährt bei Berührung in den Menschen? Aja nutzt dazu genretypische Schockeffekte, etwa wenn er ein Foto zeigt, auf dem die Hand des Dämons auf der Schulter eines der Jungen liegt.
Das offene Ende des Films mag unbefriedigend wirken, doch es wirft eine grundlegende Frage auf: Existiert das Böse wirklich?
Historische Perspektiven auf das Böse in der Philosophie
Schon früh suchten Denker nach einer Erklärung für das Böse. Augustinus sah es als Privatio boni, als Abwesenheit des Guten – nicht als eigenständige Kraft, sondern als Mangel. Thomas von Aquin griff diesen Gedanken auf und verknüpfte ihn mit der menschlichen Willensfreiheit: Das Böse entsteht dort, wo der Wille sich vom göttlichen Guten abwendet. Jahrhunderte später stellte Immanuel Kant das Böse in einen moralischen Kontext – es wurzele im „radikal Bösen“ der menschlichen Natur. Friedrich Nietzsche schließlich kehrte das Verhältnis um: Für ihn war das moralische Urteil über das Böse ein Instrument der Schwachen, um die Starken zu zügeln. Das Böse wird so zum Ausdruck schöpferischer Energie und zur Herausforderung bestehender Werte. Man könnte also mit Fug und Recht behaupten, Nietzsche war einer jener Intellektuellen, die der Faszination für das Böse erlagen und es zu glorifizieren.
Auch moderne Philosophen wie Hannah Arendt erweiterten das Verständnis: In ihrer Analyse der „Banalität des Bösen“ stellte sie fest, dass das größte Unheil nicht immer aus dämonischem Hass entsteht, sondern oft aus Gedankenlosigkeit – aus der Weigerung, moralische Verantwortung zu übernehmen. Damit verschiebt sich der Blick: Das Böse ist nicht mehr nur metaphysische Macht, sondern alltägliche Versuchung, geboren aus Bequemlichkeit, Angst oder moralischer Trägheit. Oder, wie etwas weiter unten in diesem Text ausgeführt, sogar die rationale Entscheidung seinen Lustgewinn in er bösen Gesellschaft so leicht wie sonst nirgendwo steigern zu können.
Das Böse im Spiegel der Zeit
In der Literatur und im Film wird das Böse seit jeher als Spiegel des Menschen dargestellt. Von Goethes Mephisto bis zu modernen Figuren wie dem Joker oder Hannibal Lecter zeigt sich das Böse als faszinierende, verführerische Gegenkraft. Nicht wenige Bösewichte aus Film und Literatur haben ihren Nietzsche gelesen und zumindest für sich selbst beschlossen zum Übermenschen zu werden. Ob dies auch geschieht, um sich selbst nicht als Bösewicht zu bezeichnen, bleibt eine Einzelfallentscheidung. Fest steht aber, gerade in unserer Zeit, in der Gut und Böse oft relativiert werden, scheint diese Figur eine Leerstelle zu füllen: Im besten Fall erinnert sie daran, dass moralische Grenzen existieren – und dass ihre Auflösung nicht ohne Konsequenzen bleibt.
Der moralische Diskurs der Gegenwart neigt dazu, das Böse zu psychologisieren oder zu relativieren – doch gerade diese Verdrängung macht es gefährlich. Wer das Böse nicht mehr beim Namen nennt, öffnet ihm unbewusst die Tür. Vielleicht ist das die bleibende Aufgabe des Glaubens und der Ethik: wachsam zu bleiben, wo die Welt den Unterschied zwischen Gut und Böse zu verwischen droht.
Der freie Wille entscheidet sich
Bei Thomas von Aquin und dem Allerheiligen zum Kirchenlehrer erhobene Henry Newman, steht fest, dass das Böse nur durch den menschlichen freien Willen über den Menschen herrschen kann. In Daemonen, Hexen, Spiritisten, einem Standardwerk, bringt Egon von Petersdorff es auf den Punkt:
“Immer ist es der Wille, der den Daemonen die Tore öffnet.”
Damit verlässt man die Ebene des abstrakten, schwammigen Bösen – und gelangt zum personifizierten Bösen. Man kommt beim Teufel an.
Ganz ohne Körper kommt auch das Böse in Never let go nicht aus. Zeigt es sich zuerst nur in von ihm besessenen Körpern, kommt am Ende doch ein echsenartiger Gestaltwandler hervor. Ein schuppiges Etwas, das wie das große Schlangentatoo auf dem Rücken der vor dem Bösen geflohenen Mutter vielleicht bewusst daran erinnert, dass der Satan in der Erzählung der Vertreibung aus dem Paradies als Schlange auftrat.
Teufel? Nein, danke!
Fragt man deutsche Theologen nach dem Teufel, erntet man oft mitleidige Blicke und den Hinweis, das seien doch nur Bilder, man solle bitte nicht im Mittelalter leben. Auch bei vielen Priestern klingt es ähnlich. Jene, die noch an die Existenz des Teufels glauben, beginnen oft herumzudrucksen. Selbst wer darüber spricht, fügt ein “ich will mich nicht um Kopf und Kragen reden” hinzu. Sicher ist sicher – man will es sich mit den progressiven Verbandsschäfchen und ihrem Einfluss im deutschen Teil der Katholischen Kirche nicht verderben. Für so manchen westlichen Boomer-Katholiken hat der Teufel die Welt seit dem 2. Vatikanischen Konzil verlassen. Da mag der Vatikan noch so sehr an Exorzismen festhalten.
Es heißt ja: Der größte Trick des Teufels besteht darin, den Menschen glauben zu machen, dass es ihn gar nicht gibt.
Dass es ihn gibt, davon lassen sich Progressive weder durch die Bibel noch durch den Katechismus überzeugen. Wie man als Katholik die Bibel als Gottes Wort und die kirchliche Tradition anerkennen kann, ohne an deren Inhalte zu glauben, ist mir persönlich allerdings schleierhaft. Ebenso unverständlich ist mir der Glaube, einen Schutzengel zu haben, während sie die Existenz von Dämonen – also gefallenen Engeln – ausgeschlossen wird. Vielleicht greift nicht nur in der Politik, sondern auch in der Religion eine Infantilisierung um sich. Und jene, die sich für besonders klug halten, weil sie ihre Bildung mit Universitätsdokumenten belegen können, sind am Ende die wahren Infantilen – unfähig, über den Kleinkinderglauben an den „lieben Gott“ hinauszuwachsen. Diese intellektuelle Elite weiß alles besser und steht fest auf dem Standpunkt, dass nicht sein kann, was nicht sein darf.
Dabei muss man nicht einmal an Gott glauben, um an den Satan zu glauben. Manche satanische Kulte leugnen die Existenz Gottes, nicht aber die des von ihm geschaffenen Satans.
“Eher gibt man die Gottesidee auf als den Glauben an böse Mächte: auch Atheisten zitieren noch den Teufel.” – Egon von Petersdorff, Daemonen, Hexen, Spiritisten
Der Weg des Bösen ist einfach und verführerisch
Am Satanisten lässt sich gut beobachten, warum das Böse eine stete Versuchung ist:
“Wenn es in der Welt, in der einem zu leben bestimmt ist, viel Leid gibt oder wenn die Verursachung von Leid keine Mühe bereitet und verhältnismäßig wenig Risiken birgt, ist es rational, sich für das Böse zu entscheiden, denn dann wird man aus dem verfügbaren Leid wahrscheinlich viel Lust gewinnen.” – Colin McGinn, Das Gute, das Böse und das Schöne
In seinem Roman Der Goldene Pavillon drückt es Yukio Mishima etwas kürzer aus:
“Wenn die Menschen auf dieser Welt sich in ihrem Leben und Werken dem Bösen hingaben, wollte ich so tief wie möglich in dieses Böse eintauchen.” - Yukio Mishima, Der goldene Pavillon
Der Weg des Bösen ist immer der einfachere – er verspricht den größten Lustgewinn. Das Böse verspricht das Paradies auf Erden und wirkt in jeder Ideologie, die verbrecherisch oder im demokratischen Deckmäntelchen den Menschen nach ihrem Bilde neu erschaffen will. Das Böse ist neidisch, dass es zwar zu Gottes Plan gehört, aber nur eine Schachfigur darin ist. Der Teufel würde selbst gern erschaffen, statt sich auf seine Verführungskünste verlassen zu müssen. Und hier greift vielleicht sein zweitbester Trick: Er redet den Menschen ein, er sei ihr Freund, weil er einer von ihnen sei – und weckt in ihnen den Drang, selbst Gott spielen zu wollen. Zum Übermenschen zu werden, der nicht an menschliche Moral gebunden ist und selbst definieren kann, welcher Mensch ab wann Menschwürde besitzt oder verliert.
Dass der Teufel nicht unseresgleichen ist, zeigt ein Blick in die Theologie. Wenn der Teufel den Menschen hasst und ihn zu Fall bringen will, dann auch deshalb, weil Gott den Menschen schuf, um jene Leerstelle in der Schöpfung zu füllen, die Luzifer und seine gefallenen Engel hinterlassen haben.
Nicht verstehen heißt nicht, es nicht zu ertragen
Gottes Plan ist schwer zu begreifen. Warum lässt Gott Leid zu? Ob Leibniz’ „beste aller Welten“ eine befriedigende Antwort liefert, darf bezweifelt werden. Für mich ist seine Erklärung – wie auch der Gottesbeweis des Thomas von Aquin – ein menschlicher Versuch, das Unbegreifliche zu erklären. Die Wahrheit ist: Wir haben keine Ahnung, warum nach Gottes Plan dieses oder jenes geschieht.
Doch Unwissenheit ist in einer Welt, die vergessen hat, dass auch Wissenschaft der Wahrheit nur nahe kommen kann, schwer zu ertragen. Also streicht man, verschweigt oder erklärt zu Aberglauben, was man nicht wahrhaben will oder nicht versteht.
Ich kenne keine Statistik darüber, welche Bücher der Bibel am seltensten ausgelegt werden, aber sicher gehört die Offenbarung dazu – und wohl auch das Buch Ijob. Das überrascht, weil unsere vom Untergang faszinierte Elite eigentlich ein Faible für Endzeitstimmung hat.
Im Buch Ijob ist von Beginn an klar, wer im Himmel Koch und wer Kellner ist. Dennoch irritiert, dass Gott die Wette annimmt, die Satan ihm mit Bezug auf Ijob vorschlägt – und dass er Ijob so sehr leiden lässt, nur um Satans Irrtum zu belegen. Hätte das nicht auch anders gehen können, ohne all das Unglück und den Tod?
Worauf ich hinaus will: Die Leugnung des personifizierten Bösen, die Reduktion des Teufels auf eine bloße Projektionsfläche und die rein wissenschaftliche Erklärung aller Fälle von Besessenheit sind Ausdruck einer Flucht – einer Flucht vor den schwer auszuhaltenden Fragen des Glaubens. Und vielleicht auch einer Angst, dass der eigene, zeitgeistige Glaube nichts weiter ist als das esoterische Geschwätz der Yogatante aus dem VHS-Kurs. Dass man sich Christ nennt, ohne Christ zu sein – und dass die bequemen Vorteile dieses Etiketts irgendwann verloren gehen könnten.
Doch: Wer A sagt, muss auch B sagen. Gott ohne Teufel, Engel ohne Dämonen – das geht nicht. Zumindest dann nicht, wenn man Gott nicht als bloßes Abziehbild fürs eigene Wellnessalbum versteht.
Nicht jeder, der Böses tut, ist vom Bösen besessen. Aber jeder, der Böses tut, hat sich vom Bösen verführen lassen. Er hat geglaubt, dieser Weg sei kürzer, dieser Lustgewinn verdient. Doch wie jeder Verführte hat er sich willentlich entschieden, der Versuchung nachzugeben. Die gute Nachricht: Er kann sich ebenso willentlich entscheiden, ihr zu widerstehen. Das ist oft schwieriger, wenn man einmal gefallen ist – aber die Macht des Teufels ist nicht unendlich. Sie ist begrenzt.
Schlussbetrachtung
Vielleicht besteht die tiefste Ironie des Bösen darin, dass es stets im Schatten des Guten lebt. Es braucht das Licht, um sichtbar zu werden. In einer Zeit, in der alles relativ scheint und Wahrheit zu einer Frage der Perspektive wird, bleibt das Erkennen des Bösen ein Akt des Mutes. Denn nur wer das Böse als Realität anerkennt – in sich selbst wie in der Welt – kann wirklich frei handeln. Das Böse wird uns nie verlassen, doch wir können entscheiden, wie viel Raum wir ihm gewähren.